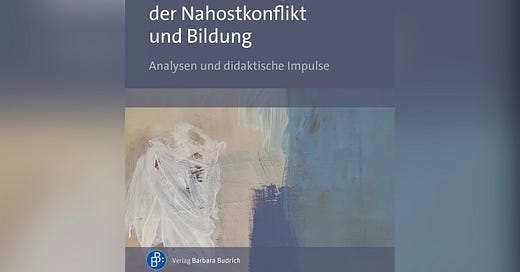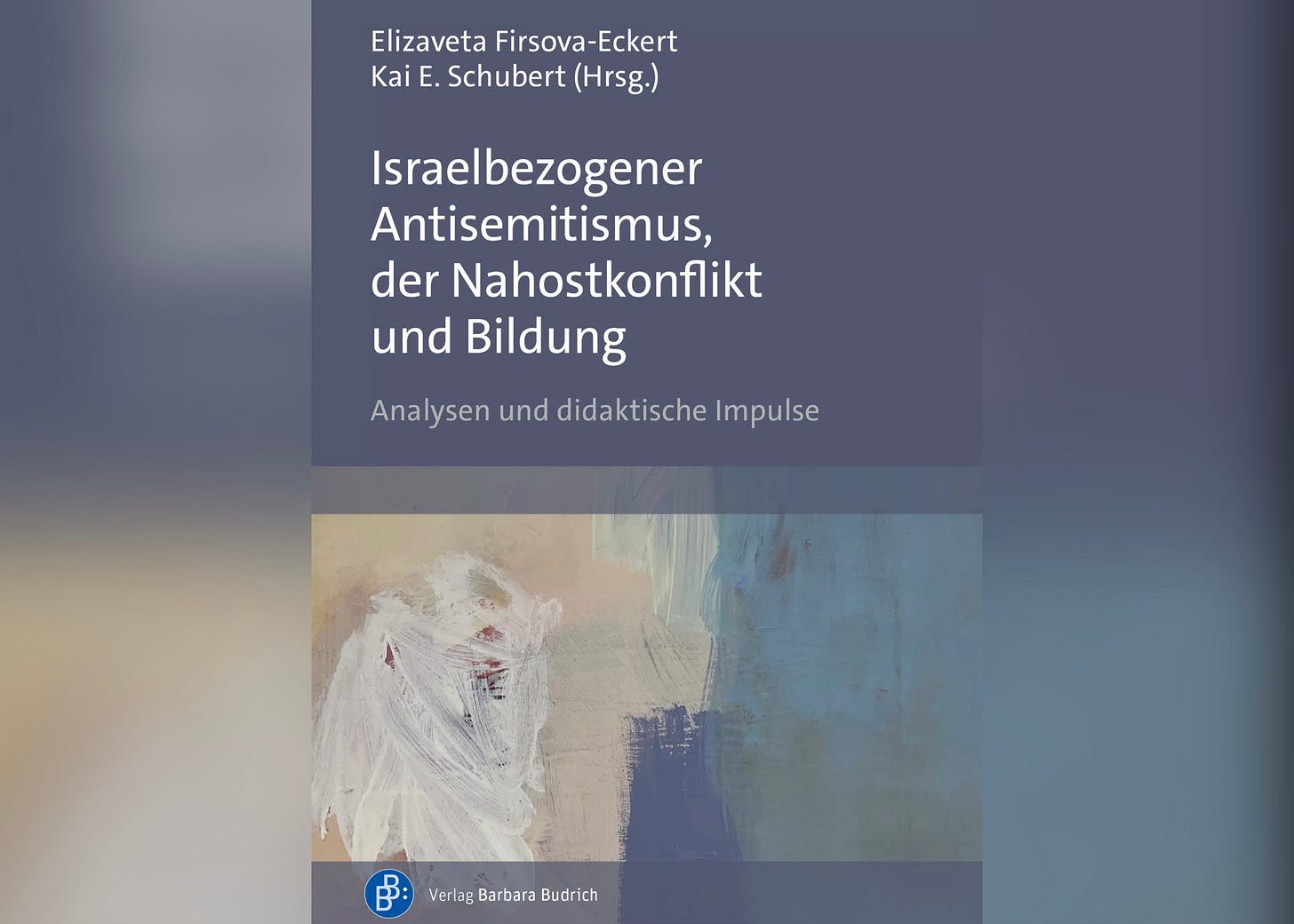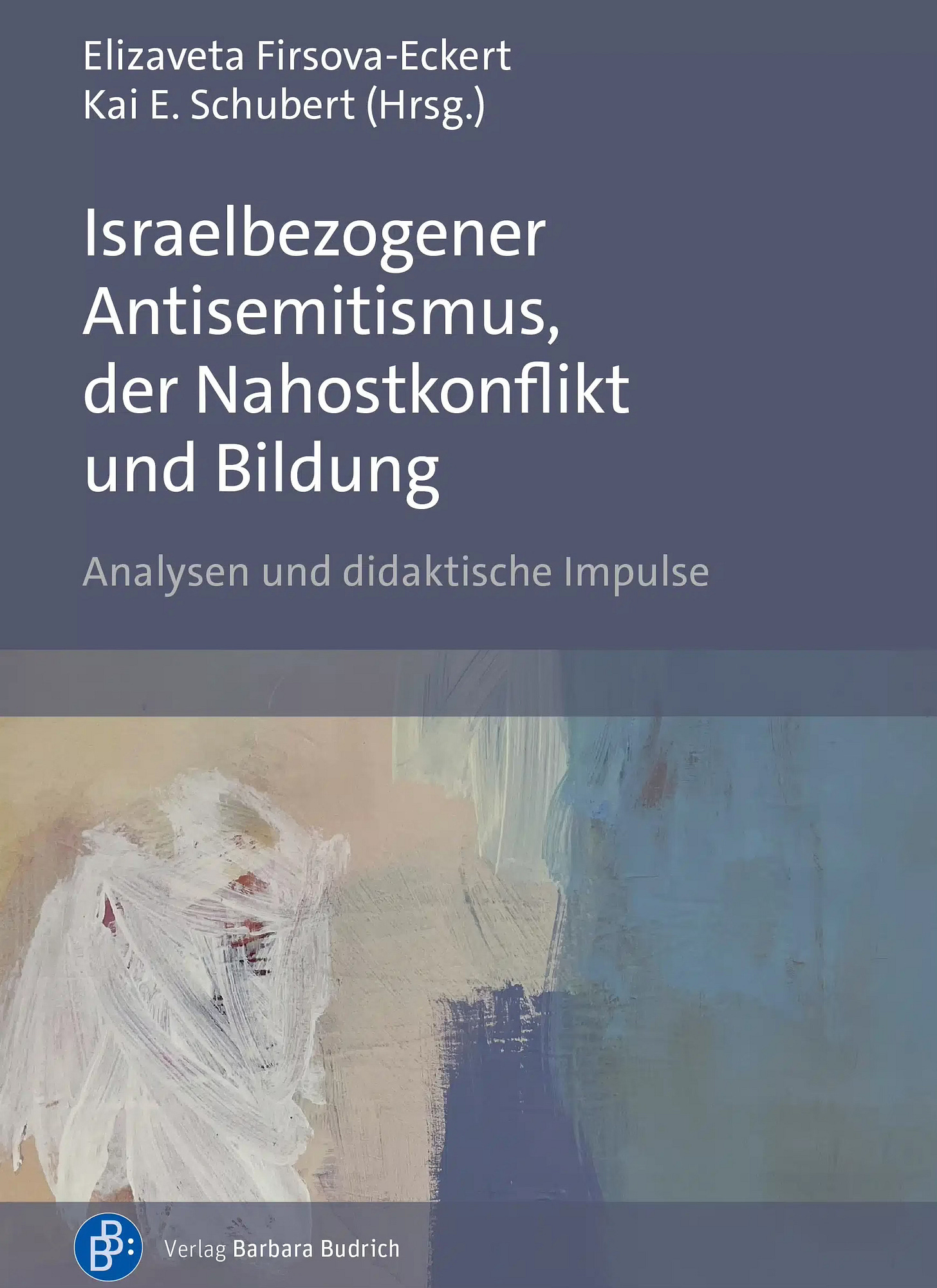Antisemitismus und der Nahostkonflikt in der Schule – der neuen Herausforderung begegnen
Seit dem brutalen Übergriff der Hamas auf ein Kibbuz in Israel am 07. Oktober 2023 ist das Thema auch im Schulalltag präsent. Wie können Lehrende mit antisemitischen Narrativen umgehen?
Der barbarische Überfall der Hamas auf den Kibbuz Be´eri stellte eine Zäsur dar, für Israel, für die israelische Bevölkerung, für jüdisches Leben weltweit, aber auch für das Leben der Menschen im Gazastreifen. In der Folge eskaliert der Nahostkonflikt erneut und die ganze Welt blickt besorgt darauf. Die Grausamkeit der Taten ist medial für eine breite Öffentlichkeit sichtbar, teilweise in unzensierten Aufnahmen. Doch nicht nur über unsere Bildschirme erreicht uns dieser Krieg, auch hier im Land bleibt der Angriff nicht folgenlos – die Zahl antisemitischer Vorfälle steigt, Jüdinnen und Juden fühlen sich auch hier nicht mehr sicher, Menschen mit palästinensischen Wurzeln fühlen sich ungehört und vorverurteilend mit der Hamas gleichgestellt.
In der Folge bilden sich sehr schnell festgefahrene Meinungen. Das Thema ist plötzlich so omnipräsent, dass es natürlich auch Schülerinnen und Schüler unterschiedlichster Altersstufen beschäftigt, auch dann, wenn sie selbst nicht direkt betroffen sind. Wie aber können Lehrende pädagogisch und didaktisch konstruktiv und antisemitismuskritisch mit diesem sensiblen Thema umgehen? Dieser Frage widmen sich die Herausgebenden Elizaveta Firsova-Eckert und Kai E. Schubert in diesem Buch, in welchem sie die Analysen, Impulse und konkrete Konzepte verschiedener Autor·innen zusammengetragen haben.
Theoretische Grundlagen wissenschaftlich basiert
Nach der Einleitung durch die Herausgebenden folgen fünf Texte unterschiedlicher Autor·innen, die sich mit der wissenschaftlichen Betrachtung des Themas „Bildung über Antisemitismus und den Nahostkonflikt“ auseinandersetzen. Der deutsche Soziologe und Antisemitismusforscher Thomas Haury beispielsweise legt in einem Interview dar, weshalb er israelbezogenen Antisemitismus nicht als alleinstehende Form des Judenhasses sieht und liefert auch gleich daraus resultierende Schlussfolgerungen, die hilfreich sein können für die pädagogische Auseinandersetzung. Der Herausgeber Kai E. Schubert und der Professor für soziale Arbeit Christoph Wolf zerlegen in ihrem Text die „curriculare Obdachlosigkeit“ der Themen Nahostkonflikt und israelbezogener Antisemitismus, also die Tatsache, dass diese Themen im Lehrplan kaum stattfinden, ein „Nischendasein fristen“ und die Intensität, in der das Thema behandelt wird, stark abhängig ist von der jeweiligen Lehrkraft.
Der Sozialwissenschaftler Sebastian Salzmann greift ein Fallbeispiel aus der Praxis auf und zeigt daran, wie schnell es passiert, dass antisemitische Sichtweisen unreflektiert reproduziert werden und sich im Laufe eines Diskurses zwischen Schüler·innen und Lehrkraft erweitern und vertiefen können. Christina Brüning, Professorin der Didaktik der Geschichte und Dr. Keren Cohen analysieren den Film „Lemon Tree“ von Eran Riklis, erörtern die Möglichkeit, ihn als Lehrmittel zum Israel-Palästina Konflikt einzusetzen und kommen zu dem Schluss, dass eine Diskussion dieses Filmes eine wertvolle Bereicherung in diesem Bereich ist. Die Herausgeberin Elizaveta Firsova-Eckert untersucht den Einfluss eines deutsch-israelischen Jugendaustausches auf die Entwicklung der Fähigkeit zu einer „differenzierten und multiperspektiven Betrachtung des Konfliktes“.
Praktische Umsetzung – Fallbeispiele, Erfolge und Grenzen
Im zweiten Teil des Buches geht es um Praxisperspektiven, die veranschaulichen sollen, wie die Inhalte in der Praxis vermittelt werden können, welche didaktischen Wege in Frage kommen, welche funktionieren und wo sie an ihre Grenzen stoßen. Die Soziologin Amina Nolte und die Politikwissenschaftlerin Helen Sophia Müller sprechen im Interview mit der Bildungsreferentin Johanna Voß über ihr Projekt „Israel-Palästina-Bildungsvideos“, mit dem sie selbst Bildungsmaterial geschaffen haben. Die Erziehungswissenschaftlerin Dr. Rosa Fava präsentiert in ihrem Text Leitlinien wie in der Jugendarbeit sowohl antisemitismus- als auch rassismuskritische Arbeit möglich ist und einer einseitigen Solidarisierung entgegengewirkt werden kann. Michael Sauer, Fachberater für Sozialkunde, sieht eine gute Vertrauensbasis zwischen Lernenden und Lehrkräften als Schlüssel zu einer erfolgreichen Prävention von israelbezogenem Antisemitismus, auch unter Berücksichtigung der identitätsbildenden Komponente. Der Lehrer Max Munz sucht (und findet) niederschwelliges Material für den Unterricht an Haupt- und Werkrealschulen und zum Abschluss beleuchtet Enno Stünkel das Gedankenmodell der „antisemitischen Situation“, das dazu einlädt, die eigene Position in ebendieser Situation zu reflektieren und gegebenenfalls zu überdenken.
Fazit: Ein wertvoller Überblick und konkrete Konzepte
Mit dem gewaltsamen, grausamen Übergriff der Hamas hat sich die ohnehin schon komplizierte Lage im Nahen Osten noch einmal beispiellos verschärft und die Ereignisse sind öffentlich so präsent und zugänglich wie nie zuvor und man hat das Gefühl, dass von jedem/jeder Einzelnen verlangt wird, auf der Stelle eine klare Meinung und am besten noch die passende Lösung zum Nahostkonflikt zu haben. Gleichzeitig glauben sehr viele, die einzig richtige Meinung bereits zu haben und lassen keinerlei abweichende Nuancen mehr zu.
Eine der wichtigsten Grundlagen, um den Nahostkonflikt diskutieren zu können, ist das Wissen um die antisemitischen Narrative, die noch immer an vielen Stellen wie selbstverständlich reproduziert werden und die heute häufig hinter Kritik an der israelischen Regierung und deren Politik versteckt werden. Den Nahostkonflikt verkürzt und einfach verständlich zu erklären, ist in seiner ganzen Komplexität nicht immer machbar, aber in Schulen, anderen Bildungseinrichtungen oder auch in der Jugendarbeit werden Lehrende und Betreuende regelmäßig mit dem Thema in all seinen Facetten konfrontiert. Dem steht gegenüber, dass im Unterricht Antisemitismus in der Regel oft „nur“ in Zusammenhang mit der NS-Zeit ausführlicher besprochen wird und den Lehrkräften darüber hinaus auf diesem Gebiet kaum geeignete Lehrmittel zur Verfügung stehen.
Die Herausgebenden liefern mit diesem Buch einen wertvollen Beitrag mit zahlreichen fundierten Quellen, um Lehrenden und Betreuenden einen Zugang zur Thematik zu öffnen. Die Textsammlung ist nicht nur für Lehrkräfte unterschiedlicher Schularten geeignet, vielmehr bietet das enthaltene Wissen und die weiterführende Literatur für alle, die in irgendeiner Form mit Jugendlichen arbeiten oder vermehrt mit Jugendlichen in Kontakt sind, eine gute Grundlage für die Behandlung der Themen Antisemitismus und Nahostkonflikt. Wie entscheidend der Umgang mit diesem sensiblen Thema in dieser prägenden und identitätsbildenden Lebensphase ist, kann man sich vorstellen, umso größer ist die Herausforderung für alle, die damit konfrontiert sind.
Wir alle wünschen uns eine Gesellschaft, in der alle Menschen angstfrei und ohne Diskriminierung leben können – in Schulen und anderen Begegnungs- und Bildungsstätten haben wir die Chance, sichere Räume zu schaffen, die einen offenen Austausch und vorurteilsfreie Perspektivenwechsel ermöglichen und in dem die Jugendlichen begleitet zum kritischen Denken animiert werden, um eigenständig Antworten auf ihre Fragen finden zu können. Dafür finden die Lesenden in diesem Buch großartige Denkanstöße und innovative pädagogische Konzepte auf Basis wissenschaftlicher Beobachtungen.
Der Verlag Barbara Budrich hat netterweise ein Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt.
Israelbezogener Antisemitismus, der Nahostkonflikt und Bildung
Elizaveta Firsova-Eckert, Kai E. Schubert (Hrsg.)
Verlag Barbara Budrich, 174 Seiten
46,00 Euro oder online als Creative Common